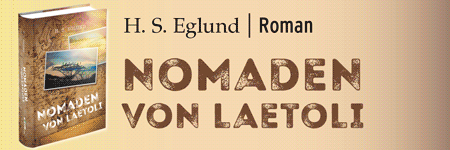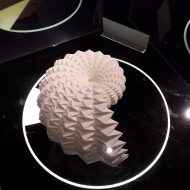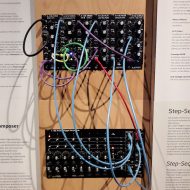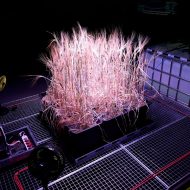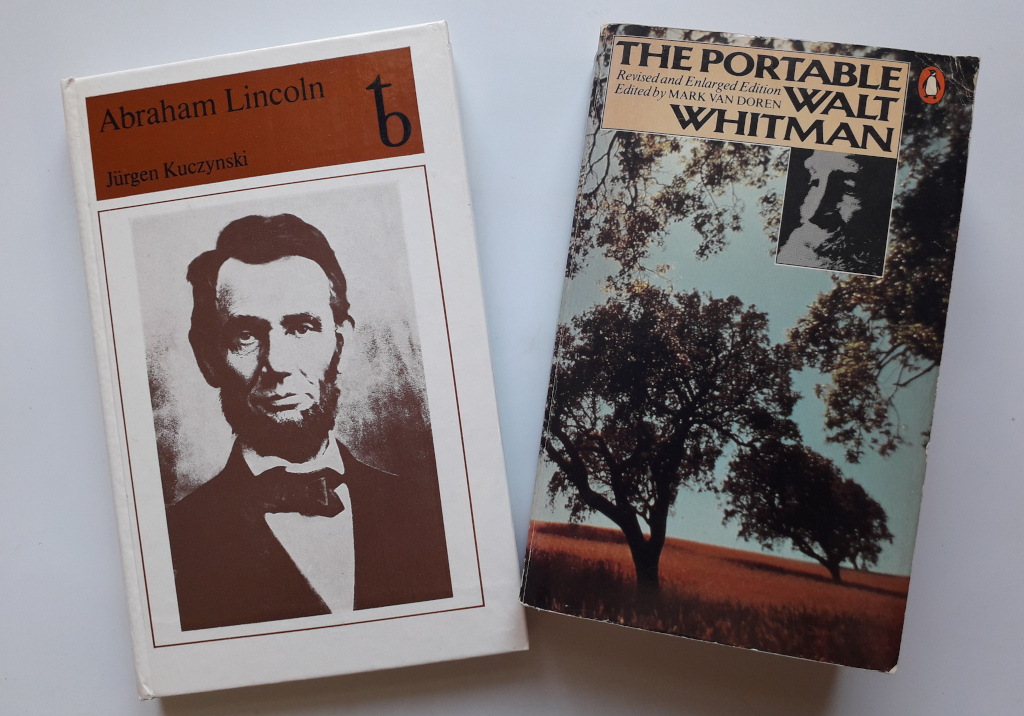Der Silberbergbau in Sachsen ist mindestens 800 Jahre alt. Erstmals werden die Gruben bei Scharfenberg im Meißner Land im März 1222 erwähnt, in kaiserlicher Depesche. Grund genug für Eglund, als gelber Zwerg selber in den Stollen einzufahren – zu einer faszinierenden Zeitreise.
Am 23. März 1222 entschied Friedrich II., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation einen merkwürdigen Streit: Der Bischof von Meißen und der Markgraf stritten um die Silbergruben bei Scharfenberg, einer kleinen Stadt im Bistum Meißen. Der Streit berührte eine grundsätzliche Frage des mittelalterlichen Bergbaus: Wem gehörten die Gruben? Dem Kirchenherr, also Rom? Oder dem Gutsherren, der weltlichen Macht?
Das Bergregal entmachtete die Grundherren
Damals verfügte der Kaiser, wer die Gruben ausbeuten durfte. Im sogenannten Bergregal entschied der Kaiser zugunsten des Bischofs, der mit dem Silber den Bau des Meißner Doms finanzierte, eines der gewaltigsten Bauwerke seiner Zeit. Wenig später, 1232, sprach der Kaiser dem Landesfürsten eigene Gruben zu, um die Interessen auszugleichen.
Das Bergregal sprach dem Kaiser das Privileg zu, über den Abbau kostbarer Erze zu verfügen, unabhängig vom Landeigentum der Territorialfürsten. Er konnte es an Bischöfe oder Könige abgeben, war nicht gebunden. Das Bergregal erlaubte zudem die Gründung freier Siedlungen wie Freiberg, Annaberg, Schneeberg oder Sankt Joachimsthal auf der böhmischen Seite.
Ein Regal für Silbermünzen
In ihren regierte das Bergrecht, nicht die Rechtsprechung des Herzogs. Der Vorteil: Mit dem Bergbau entwickelten sich das Handwerk und der Geldverkehr, denn neben dem Bergregal verlieh der Kaiser auch das Münzregal.
Bekannt sind die Zwickauer Silbermünze der Brüder Martin und Niklas Römer aus dem späten 14. Jahrhundert und die Münze der Grafen Schlick im böhmischen Joachimsthal Anfang des 15. Jahrhundert. Der Joachimsthaler ging als Silbermünze zunächst in Europa durch die Hände, wurde als harte Währung sehr geschätzt. So wurde er zum legendären Taler und später zum Dollar, der Währung der unabhängigen Kolonien in Neu-England.
Beginn im zehnten Jahrhundert
Es wird vermutet, dass der sächsische Bergbau einige hundert Jahre älter zurückreicht als die Urkunde von Kaiser Friedrich II. Vermutet werden die Anfänge im zehnten und elften Jahrhundert. Zunächst wurde Zinn aus den Bächen und Flussläufen der Berge an der Elbe und ihren Zuflüssen gewaschen, man spricht von Seifen. Wo die Erzgänge aus dem Ufer traten, gingen die Seifner in den Berg.
Seitdem weckten Zinn, Kupfer, Blei, Kobalt und vor allem Silber die Gier der Mächtigen. Als Kaiser Friedrich für den Bischof entschied, setzte er die Rechte des Markgrafs von Meißen zurück. Er war der eigentliche Grundherr der Ländereien an der Elbe, doch er musste sich dem Richtspruch beugen. Das Bergregal hebelte die weltliche Macht des Fürsten aus, und dieser Konflikt sollte für die kommenden 500 Jahre auf der deutschen Geschichte lasten wie ein Fluch.
Ein Streit für 500 Jahre
Denn dieser Widerspruch – die Teilung der Macht und damit doppelte Bürden für die Bauern, Bergleute und Kaufleute – führte zum Bauernkrieg und zur Reformation. Erst mit dem Dreißigjährigen Krieg wurde die Macht der Bischöfe und Klöster gebrochen, die Machtfrage in deutschen Landen zugunsten der Kurfürsten entschieden.
Da war die frühe Phase des Silberbergbaus bereits Geschichte. Denn eine Schwemme von Silber und Gold aus den spanischen und portugiesischen Kolonien in der Neuen Welt ließ die Preise in Europa einbrechen. Der Aufwand lohnte nicht mehr.
Neue Blüte nach den Napoleonischen Kriegen
Bis ins 19. Jahrhundert, als die Silbergruben im Erzgebirge eine neue Blüte erlebten. Nun stand das industrielle Zeitalter vor der Tür. Napoleon hatte die letzten Reste klerikaler Macht beseitigt und den modernen Staat geschaffen. Die neue Zeit mit ihren Dampfmaschinen und Erfindungen hungerte nach Metallen: Eisen und Stahl, Silber, Zinn und Zink, Blei und Kobalt, Mangan und Chrom.
Die Schächte und Stollen aus dieser Zeit sind noch gut erhalten. Manche werden von Traditionsvereinen und der Bergaufsicht wieder freigelegt. Ganz alte Gruben aus dem zwölften oder 13. Jahrhundert erkennt man meist nur an den Pingen (Bergbrüchen), die sie an den bewaldeten Hängen hinterließen. Die alten Stollen sind verschlammt, versandet, eingestürzt, längst ist das Holz der Türstöcke und zur Sicherung der Mundlöcher verrottet.
Ein Erbstollen aus dem Jahr 1817
In Scharfenberg wurde vor wenigen Jahren ein Erbstollen von 1817 freigeräumt, der zur Entwässerung der Grube Güte Gottes diente. Er wurde instandgesetzt und bergtechnisch gesichert, um die Entwässerung der alten Hohlräume aus dem Bergbau zu gewährleisten. Andernfalls besteht die Gefahr, dass sie unkontrolliert einsacken oder das Wasser neue Hohlräume in den Berg wäscht.
Start und Ende der Begehung des König-David-Erbstollens Mitte März 2022 war das ehemalige Huthaus, das Verwaltungsgebäude der Grube. Sie war bis 1898 in Betrieb – bis zum endgültigen Aus der Silberförderung in diesem Gebiet.
Das Huthaus mit dem Hoffnungsschacht
Der Scharfenberger Verein, der mit viel Engagement den Silberbergbau aufleben lässt, und die Eigentümer des Geländes haben das Huthaus zu einem kleinen Museum ausgebaut. Hier endet der Hoffnungsschacht, der zur Entlüftung und als Förderschacht für die Grube diente.
Zünftig mit Gummijacke, Gummistiefeln, Plastikhelm und Grubengeleucht ausgestattet, machte sich eine Gruppe Interessierter auf, wie gelbe Zwerge auf dem Weg unter die Erde. Geführt wurde sie von einem kundigen Mitglied des Vereins, der viel Wissenswertes über die silberne Vergangenheit von Scharfenberg erzählte.
Viele alte Häuser von damals
In Scharfenberg stehen noch viele alte Gebäude aus dem 16. und 17. Jahrhundert, die als Steigerhäuser, als Schmiede oder Bethaus zur Grube gehörten. Heute werden sie meistenteils als Wohnhäuser genutzt, wie auch das Huthaus der Grube, in dem der Hoffnungsschacht zur Oberfläche aufsteigt.
Das Mundloch des König-David-Erbstollns befindet sich etwas oberhalb der Elbe, fast unmittelbar am Ufer, nur getrennt durch die Bundesstraße, die hier dem Flusslauf hautnah folgt. Er wurde ab 1817 vorgetrieben, um die erzhaltigen Gruben zu entwässern und das Erz aus der Grube zu fördern – über spezielle Grubenwagen, Hunte genannt.
Dreck, Enge, Kälte – schwere Arbeit untertage
Unter der Erde bekommt man einen Eindruck, wie schwer die Arbeit der Bergleute war, und wie gefährlich: Dreck, Staub, Enge, Dunkelheit, Kälte und natürlich das drohende Deckgebirge machten die Arbeit untertage zur Schinderei. Hier wurde das Erz mit der Hand, mit Bergeisen und Schlägel gebrochen, und selten wurden die Bergleute älter als vierzig Jahre.
Zwar gab es im Scharfenberger Revier kein radioaktives Uranerz (Pechblende) wie in Annaberg, Schneeberg und Joachimsthal (Jachymov). Dennoch litten und siechten die Bergleute an Staublunge, am Rheuma, an Knochenbrüchen oder starben bei Unfällen: Bergsturz, Wassereinbruch, matte Wetter durch mangelnde Belüftung.
Aufwändige Aufbereitung und Verhüttung
Das Erz wurde von Huntsknechten mittels Hunten aus dem Berg gekarrt und von Scheidejungs an der Scheidebank begutachtet. Mit kundigem Blick trennten sie das Reicherz von taubem Gestein.
Anschließend wurde das Erz im Pochwerk unmittelbar am Elbufer durch gewaltige, mit Eisen beschlagene Eichenstempel zerkleinert, zu Mehl zerstoßen, mit Wasser verschlämmt und im Absetzbecken mit Holzschiebern abgezogen. Danach wurde der Silberstaub nach Freiberg gebracht, um ihn zu rösten und zu Barren zu schmelzen.
Bleihaltige Minerale lieferten Silber
Weil die Erze sehr bleihaltig waren, litten schon die Scheidejungen an Vergiftungen, wurden nicht alt. Vor allem das Mineral Bleiglanz (Galenit) wurde abgebaut, das recht hohe Anteile von Silber aufwies. Die Gesteine der Region sind durch Gneise gekennzeichnet. Zudem findet man Manganspat, Edelspat, rötlichen Granit (Feldspat), Pyrite (Mineralien mit Eisen und Schwefel), Quarz und Glimmer, ebenso Kaolin.
Die Berge sind reich, bis heute. Durch den jahrhundertelangen Bergbau sie sind zerlöchert wie Schweizer Käse. Die Begehung des Erbstollens erwies zahlreiche Nebengänge, Stummelstollen und verschüttete Strecken, in denen früher offenbar Silbererz abgebaut wurde. Noch sind einzelne Erzgänge im Granit sichtbar.
Aufwand für den Bergbau wuchs
Tektonisch gehört das Scharfenberger Revier zum Freiberger Gebirge und dem Erzgebirge. Zu Beginn der Erzabbaus wurden Zinn und Silber sogar gediegen gefunden, unmittelbar in den Ufersedimenten der Bergbäche, faktisch unter der Rasennarbe.
Mit zunehmendem Abbau wuchs der Aufwand, um an die begehrten Erze zu kommen. Immer tiefer wurden die Schächte abgeteuft, bis weit unter den Spiegel des Grundwassers. Damit mussten die Schächte und Stollen künstlich entwässert werden, durch Erbstollen oder durch Hebeanlagen mit Haspeln und Eimern.
Viele hundert Kilometer Stollen
Die zunehmende Länge der Erzstollen – im Erzgebirge summieren sie sich auf hunderte Kilometer – machte die künstliche Belüftung erforderlich. So fungierte der König-David-Erbstollen zugleich als Luftröhre, um die Abluft der Bergleute und die Sprenggase aus dem Berg zu führen und Frischluft einzusaugen.
Im Dreißigjährigen Krieg, als der Bergbau aufgrund des Krieges am Boden lag, dienten die alten Schächte den Einheimischen als letzte Zuflucht. Wenn marodierende Horden das Land durchzogen, plündern, brandschatzend und mordend, versteckten sich ganze Dörfer in den dunklen Stollen.
Die hohe Kunst der Bergleute
Als der König-David-Erbstollen angelegt wurde, dämmerte bereits das 19. Jahrhundert. Noch hatte der Bergbau nicht das industrielle Ausmaß angenommen, weil es zwar das spröde Eisen gab. Aber die Herstellung von Stahl – durch die Beigabe von Kohle – kam erst auf. Auch Dampfmaschinen und Pumpentechnik standen noch am Anfang.
So bekommt man auch einen Eindruck, wie ein solcher Stollen alle drei Kilometer durch senkrechte Lichtschächte angebohrt und dann horizontal von zwei Seiten aus dem Fels geschlagen wurde. Die Markscheider, die den Vortrieb mit Lot und Kompass berechneten, waren wahre Meister.
Denn die einzelnen Stollenabschnitte trafen millimetergenau aufeinander. Zudem hat der Erbstollen über etliche hundert Meter eine exakt eingestellte Neigung, damit das Wasser frei abfließen kann, ohne dass die Sohle mit der Zeit verschlammt.
Das ganze Leben im Stollen
Der Aufwand war beträchtlich: Legionen von Bergleuten brachten ihr gesamtes Berufsleben in ein und dem selben Stollen zu, denn das harte Gestein erlaubte den Vortrieb stellenweise nur millimeterweise. Zwar erleichterte Schwarzpulver und später Dynamit die Arbeit, ihr Einsatz war aber von neuen Gefahren begleitet.
Teilweise wurden die Stollen durch Türstöcke und Stempel aus Holz abgesichert oder mit Ziegeln vermauert. Das Holz, das im feuchten Berg schnell faulte, musste alle sieben Jahr erneuert werden.
Das Ende des Miriquidi
Das ist der Grund, warum die Berge in alten Darstellungen – etwa bei Agricola – nahezu kahl erscheinen. Längst war der alte Urwald, der legendäre Miriquidi, für den Bergbau und die Siedlungen der Bergarbeiter gerodet und verschwunden.
Die heutigen Wälder sind spätere Aufforstungen, weil der Mangel an Bauholz im 15. und 16. Jahrhundert die Wirtschaftlichkeit der Gruben gefährdete. Zudem bekam jeder Bergmann eine bestimmte Menge Bauholz für seine Hütte zugesprochen – quasi als Mitgift. Vor allem arme Bauern aus Franken waren es, die dem Berggeschrey des Herzogs von Meißen folgten und das sächsische Bergland besiedelten.
Das Aus für die Silbergruben
Im Scharfenberger Revier waren die Erzgänge anfangs sehr reich, bis zu drei Meter dick. Die Zeiten sind längst vorbei. Heute lohnt der Abbau nicht mehr, die letzte Grube machte 1898 dicht. Damals führten London und Washington den Goldstandard ein. Silber als Basis der Währungen verlor schlagartig an Bedeutung.
Dass Silberdraht in der Elektrotechnik aufgrund seiner exzellenten Leitfähigkeit eine herausragende Rolle spielte, stoppte den Preisverfall nicht. Kupfer und optimierte Legierungen aus Stahl boten wirtschaftliche Alternativen.
1898 – Geburtsjahr des Atomzeitalters
1898 war auch das Jahr, in dem das Uran seinen Zug durch die Geschichte begann. In Paris entdeckte Henri Becquerel die Radioaktivität. Marie und Pierre Curie gelang es, Radium zu isolieren – aus der Pechblende einer ehemaligen Silbergrube in Sankt Joachimsthal in Böhmen. Jahrhundertelang wurden die Uranerze als wertloses Taub auf Halde geworfen.
Als das Berggeschrey des Silbers im Erzgebirge und in Böhmen verklang, machte sich der Radium Rush auf – weltweit. Der Bergbau von Pechblende und Uran im Erzgebirge, die Atombombe und der nukleare Meiler – das ist eine andere Geschichte. Ihre Anfänge aber lagen in Scharfenberg un dim Erzgebirge, und sie liegen noch dort, tief unter der Erde.
Zur Industriegeschichte lesen Sie auch:
Video: Eglund am Solarfeld in Groß-Dölln
Video: Eglund am Solarfeld in Groß-Dölln (2)
Video: Mit Eglund am Kohlekraftwerk in Schwarze Pumpe
Video: Eglund am Tagebau Welzow-Süd in der Lausitz
Zen Solar – Roman der Energiewende