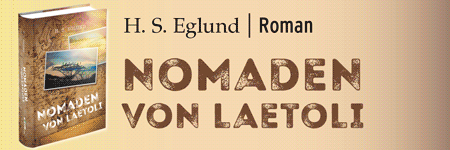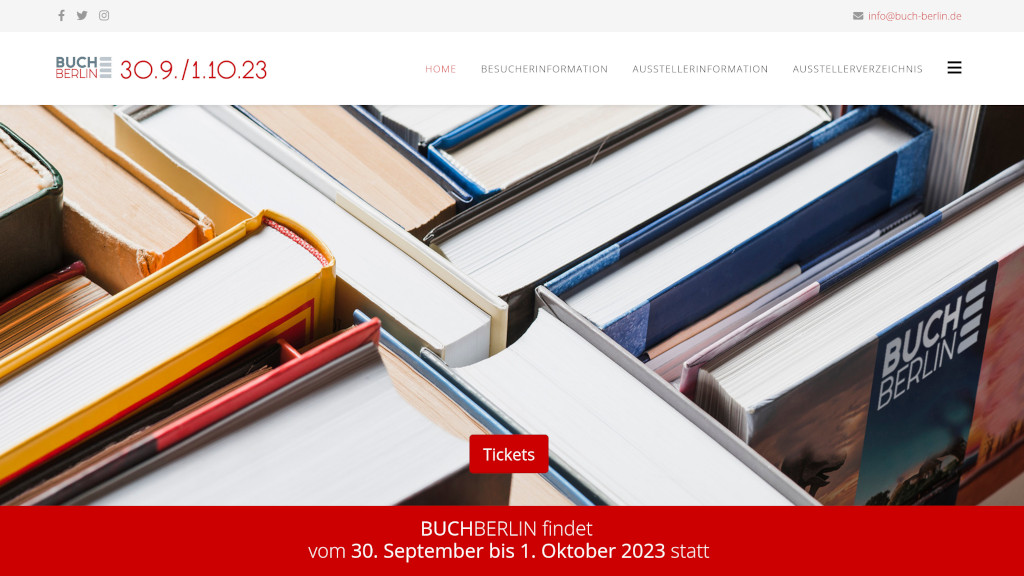Der Klimawandel macht den Wäldern zu schaffen – weltweit. Mit Macht dringt die Hitze vor. Wird die grüne Erde zu Dune, dem Wüstenplaneten? Beobachtungen aus British Columbia, im Westen Kanadas.
Sicamous ist ein malerisches Nest. Inmitten grüner Berge klebt es am Shuswap Lake, dessen vier Arme weit in die Schluchten der Rocky Mountains greifen. Vom Eagle River gellt der Schrei des Bald Eagle, des Weißkopfseeadlers. Was für ein majestätisches Tier!
Feuer gab es immer, aber …
Ron Stanton sitzt vorm Motel, dreht seine Mütze in der Hand. Er ist Pensionär, hat vierzig Jahre bei BC Hydro gearbeitet, dem Energieversorger der Provinz im äußersten Westen von Kanada. Sein Gesicht ist gegerbt vom Leben in den Rockies.
Seine Frau schleppt Taschen aus dem Pickup ins Zimmer. Sie sind müde, die beiden Alten. „Möglicherweise haben wir alles verloren“, sagt Ron heiser. „Weißt du, Feuer gab es hier immer. Aber so etwas wie in diesem Jahr …“
Der Hotelmanager bringt Wasser und spendet tröstliche Worte. Wird schon gut werden, steht in seinem Gesicht geschrieben. Ron nickt, der Manager nickt. Beide hoffen. Ron hofft darauf, dass er bald in sein Haus am Nordrand des Sees zurückkehren darf. Falls es noch steht.
Die ganze Region gesperrt
Und der Manager hofft, dass die Evakuierungen bald beendet sind. Denn die Regierung von British Columbia hat die ganze Urlaubsregion zwischen Kamloops und Kelowna für Touristen gesperrt. Nur wer unbedingt muss, darf übernachten. Der Trans Canadian Highway wurde im Abschnitt des Fraser Canyons komplett abgeriegelt, denn dort tobt eine Schlacht. Hunderte Feuerwehrleute stemmen sich gegen die Feuersbrunst. Wollen retten, was zu retten ist.
Ron und seine Frau Mary sind Evacuees, Evakuierte. Auf Anweisung der Behörden mussten sie ihr Haus räumen. Die verheerenden Brände sind bis an die Grenzen von Kamloops und West Kelowna gekrochen. Doch nicht nur im Süden der Provinz brennt es. Faktisch stehen die Wälder bis nach Alaska in Flammen. Sie lodern bis nach Kalifornien, auf der US-amerikanischen Seite der Grenze.
Yellowknife komplett evakuiert
In den nordwestlichen Territorien gingen riesige Flächen ins Asche auf. Die Provinzhauptstadt Yellowknife wurde komplett evakuiert. Dort lebten 20.000 Menschen. Zwischen Kamloops und Kelowna sind rund 30.000 Menschen von Evakuierungen betroffen. Der Shuswap-See liegt inmitten dieser ausgedehnten Waldregion.
Auch im Osten Kanadas brannten die Wälder, zeitweise verdunkelte der Rauch den Himmel von New York. Über Vancouver, der malerischen Stadt am Pazifik, lag tagelang gelblicher Smog. Auflandige Winde trieben den Rauch der Brände auf Vancouver Island über die Strait of Georgia in die Metropole, dass sogar die Kuppen der Berge verschwanden.
Ausmaß der Brände überrascht
Waldbrände hat es in Nordamerika immer gegeben. Schon im ersten Roman der amerikanischen Literaturgeschichte spielen sie eine dramatische Rolle: In James Fenimore Coopers Lederstrumpf stirbt der Indianerhäuptling Chingachgook vor der Glutkulisse eines Buschfeuers. Deshalb sind die Kanadier mit dem Phänomen vertraut – und gewappnet.
Normalerweise. Denn in diesem Sommer hat das Ausmaß der Brände selbst die hartgesottenen Fire Fighters von British Columbia überrascht. Mehr als 15 Millionen Hektar Waldfläche wurden vernichtet, etwas die Hälfte Deutschlands. Und weit mehr, als der gesamte deutsche Wald zusammengenommen. Zum Glück gab es in Kanada bislang nur sehr wenige Opfer.
Kein kanadisches Phänomen
Die Brände waren kein kanadisches Phänomen. Aus dem Westen der USA, aus Alaska, Australien, Teneriffa und Griechenland erreichten uns ähnliche Horrorbilder. Auf Hawaii brannte Lahaina nieder, innerhalb von einem Tag und einer Nacht – die Zahl der Opfer steht noch nicht fest, geht aber in die Hunderte.
Angesichts solcher Fernsehbilder versucht sich Ron in Optimismus. „Wir sind gesund, wir sind in Sicherheit“, sagt er. „Unsere Kinder leben in Ottawa und Halifax. Eigentlich können wir von Glück sagen, dass nichts schlimmeres passiert ist.“
Innere Flüchtlingsströme verändern die Debatte
Wochenlang dominierten die Waldbrände die öffentliche Debatte im Norden Amerikas. Mittlerweile geht es nicht mehr nur um örtliche „Wildfires“. Der Strom von mehr als 50.000 Flüchtlingen innerhalb Kanadas erreicht eine soziale Dimension. Offenbar sind die Wälder derart ausgetrocknet, dass der kleinste Funke genügt, um das Inferno auszulösen. Nirgendwo sind die Menschen wirklich sicher.
In fast 90 Prozent der Fälle sind die Brände von Menschen verschuldet: Glutreste der Lagerfeuer von Wanderern, achtlos weggeworfene Zigarettenstummel oder Glasscherben, in denen sich das Sonnenlicht wie in einem Brennglas bündelt.
In Lahaina war es das fragile, veraltete Stromnetz, das den Brand während eines Sturms auslöste. Nur wenige Brände entstehen auf natürliche Weise: durch Blitzschlag bei Trockengewittern.
Sehr frühe und lange Trockenheit
Neu in Kanada war auch die Länge der Feuerperiode. Schon im Juni wurden die ersten Flächenbrände gemeldet. Man muss wissen, dass der Winter in den Rocky Mountains meistens bis in den April reicht, so lange liegt Schnee. Sechs oder acht Wochen nach der Schmelze haben ausgereicht, um die Böden und Wälder nahezu vollständig auszutrocknen.
Wenn es brennt, beschränken sich die kanadischen Feuerwehren meist auf den Schutz der spärlichen Siedlungen. Die Wildnis ist derart unzulänglich, dass selbst Flugzeuge kaum etwas ausrichten können.
Graues, nacktes Totholz
Anders in Europa: Hier gibt es faktisch keinen Urwald mehr wie in Kanada. Hier wurde der Wald in der Regel nach dem Raubbau des Mittelalters neu angelegt.
Der deutsche Wald verfügt lediglich im Schwarzwald und in den Alpen über einige Reste des ursprünglichen Dschungels. Die überwiegende Mehrheit der Flächen ist von forstwirtschaftlich geprägten Monokulturen besetzt. Ein gefundenes Fressen für Flammen und Käfer gleichermaßen.
Im Westen Kanada sieht man enorme Flächen, auf denen die Feuer vergangener Jahre gewütet haben. Dort stehen keine grünen Föhren mehr. Dort ragt graues, nacktes Totholz in den Himmel. Oft dauert es Jahrzehnte, bis sich der Wald regeneriert – wenn er dafür genug Niederschläge bekommt.
Flammen und Käfer setzen den Wäldern zu
Teile der Rocky Mountains sind dauerhaft verwüstet, ihre Buckel und Gipfel bleiben blank. Ohne Wald kann sich der Mutterboden nicht halten, wird vom nächsten Starkregen oder mit der Schneeschmelze ins Tal geschwemmt.
Was in Kanada die Feuer erledigen, schafft in Deutschland der Borkenkäfer. Die ausgetrockneten Stämme sind gestresst, die Käfer fressen sich ungehindert durch die Rinde in den Stamm. Der Thüringer Wald – Legende für viele Sagen – ist mehr oder weniger zum bleichen Gerippe verkommen. Ebenso sieht es am Brocken aus und in weiten Teilen des Alpenvorlands.
Öffentliche Meinung wandelt sich
Kanada ist stolz auf seinen Wald, roter Ahorn prägt die Landesfahne. Ron sagt: „Das kann nicht so weitergehen. Wer jetzt noch am Klimawandel zweifelt, den lade ich gern in mein Haus ein. Wenn es noch steht.“
Mit Wucht haben sich die Bilder der Flammen, der erschöpften Feuerwehren und der verzweifelten Evacuees in die öffentliche Meinung Kanadas gebrannt. Selbst in den konservativ regierten Provinzen Alberta und Saskatchewan versichern nun Politikerinnen und Politiker eilfertig, der Klimawandel ernst nehmen zu wollen.
Die Nordwest-Territorien werden vom Bergbau dominiert: Ölschiefer, Uran, Gold und andere Metalle werden dort geschürft. Langsam dämmert auch dort den Behörden, welchen Preis der Raubbau an der Natur hat.
Strom aus Wasserkraft und Atommeilern
Bislang waren die Kanadier fein raus: Die Erzeugung von elektrischem Strom basiert wesentlich auf Wasserkraft (mehr als 60 Prozent). Die gigantischen Flüsse sind durch nicht minder gigantische Dämme gezähmt.
Hinzu kommen Atomkraftwerke, die vor allem in der Provinz Ontario zur Stromversorgung beitragen. 15 Atommeiler laufen in dieser industriell geprägten Provinz, einer in New Brunswick. Der Atomstrom deckt rund 14 Prozent des kanadischen Gesamtbedarfs, in Ontario rund die Hälfte. Der einzelne Meiler in New Brunswick sichert knapp ein Viertel des Strombedarfs dieser kleinen, maritimen Provinz am Atlantik.
2021 hat Kanada ungefähr ein Gigawatt an Windstrom und Solarstrom installiert. 2022 waren es bereits knapp sechs Gigawatt. Dennoch importiert das Land vor allem Öl, Gas und Kohle, die anderswo verheizt werden.
Dürre setzt Bauern unter Druck
Der extrem trockene Sommer in Kanada hat zudem eine der konservativsten Gruppen der Bevölkerung aufgeschreckt: die Weizenfarmer der Prärieprovinzen Alberta, Saskatchewan und Manitoba. Durch die fehlenden Niederschläge konnten die Ähren kaum ausreifen.
2022 hatte es eine Rekordernte gegeben: 34,7 Millionen Tonnen Weizen wurden geerntet, 55 Prozent mehr gegenüber Vorjahr – das ebenfalls ein Dürrejahr war. 2023 mussten viele Bauern ihre Schläge noternten. Denn auch auf den riesigen Anbauflächen drohten unkontrollierte Brände.
Brände setzen Millionen Tonnen Kohlendioxid frei
Mary hat die Habseligkeiten im Zimmer des Motels verstaut, setzt sich zu uns. Sie bemüht sich um Gelassenheit, reicht kühle Getränke. „Wir sind davongekommen“, sagt sie salomonisch. „Wenn noch etwas von unserem Haus steht, werden wir es wieder aufbauen. Wenn nicht, müssen wir schauen, was wir machen. Vielleicht ziehen wir dann zu unserem Sohn an die Ostküste.“
Sorgenvolle Blicke wandern gen Norden, wo man den fernen Rauch vage erkennen kann. Wolkengleich hängt er zwischen den dunklen Bergrücken jenseits des Shuswap Lake. Nach Schätzungen von Wissenschaftlern werden die Waldbrände den Klimawandel beschleunigen.
Normalerweise speichert der Wald Kohlendioxid, baut es chemisch ins Holz ein. Durch die Brände werden Millionen Tonnen freigesetzt, allein rund 290 Millionen Tonnen in diesem Jahr. Der kanadische Rauch gelangt mit Höhenwinden bis nach Europa, ein kaum sichtbarer Schleier durchzieht die Atmosphäre – rund um den Globus.
Ein bedrohtes Paradies
Roter Abend senkt sich über das Felsengebirge. Die Adler schreien, geisterhaft gellt ihr Ruf durch die Flussaue. Die Stantons haben in ihrem Leben viel gesehen, einige Katastrophen durchlebt. Ron erzählt von Dammbruch oder Beinahe-Dammbruch, von Feuern, die Strommasten bedrohten und von sintflutartigen Regenfällen, wie sie gelegentlich in British Columbia vorkommen, vor allem auf der pazifischen Seite.
Oder vom Blizzard vergangene Weihnachten, als halb Kanada und USA unter dichtem Schnee und eisiger Kälte verschwand. „Irgendwie wird es weitergehen“, schließt er. „Irgendwie ist es immer weitergegangen. Muss ja!“ Wir stoßen an.
Der Manager kommt. Er macht den Stantons ein besonderes Angebot – halber Preis, „so lange Ihre Evakuierung dauert“. Er setzt sich zu uns, wirkt deprimiert.
Kein Wunder, viele Buchungen wurden wegen der Brände storniert. „Normalerweise können wir uns um diese Jahreszeit vor Besuchern kaum retten“, meint er. „Und jetzt? Sie sehen es ja selbst. Tote Hose, nothing is going on.“ Auch er gönnt sich ein Bier. „Es ist eine Idylle, hier bei uns am Shuswap, ein kleines Paradies. Wie es aussieht, ist es ziemlich bedroht.“
Lesen Sie auch:
Ein Hauch von Ewigkeit: Thomas Mann in Nida
Coleridge: Aus Liebe zur Natur – aus Menschenliebe
Harriet Beecher Stowe: Großer Kampf einer kleinen Frau
Heinrich Böll: Wir kommen von weither
Stefan Heym – ein später Nachruf
Hemingway: Alter Mann ohne Meer