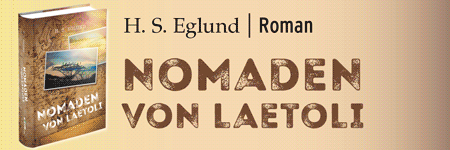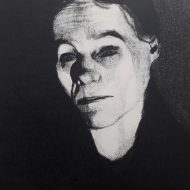Einstein in Caputh – wo Gott nicht würfelt
Das einstige Sommerhaus des Physikers ist Ort zur Erinnerung. Es hat Nazis, Bomben und Streit überstanden. Stille Idylle, versteckt und grün – scheinbar unberührt von der Zeit.
Wie ein Ring legen sich Seen und Dschungel um Potsdam, den südwestlichen Vorort von Berlin. Potsdam, das mit Sanssouci prahlt und den preußischen Militarismus preist. Potsdam, wo sich die Sieger trafen, im Schloss Cecilienhof am Ende des Krieges.
Sie hatten den braunen Erben des Alten Fritz den Garaus gemacht, das Nazigeschmeiß erledigt. Da lebte Albert Einstein schon ein Dutzend Jahre in Übersee – und kehrte nie zurück.
Nest mit Puppenschloss
Geblieben sind der Einsteinturm auf dem Telegrafenberg und sein früheres Sommerhaus in Caputh. Das Dorf liegt südwestlich von Potsdam, die Caputher Gemünde verbindet den Templiner See mit dem Schwielowsee, wunderschöne Wasserlandschaft der Havel.
Es ist ein verschlafenes Nest mit restauriertem Puppenschloss, das im Sommer behäbige Touristen anzieht. Ein glückliches Stück Brandenburg, sehr wohlhabend. Ein Viertel der Wähler machen ihr Kreuz bei der AfD, stärkste Kraft im Ort. So kehrt der braune Sumpf zurück, der Einstein einst vertrieb.
Ganz oben auf der Todesliste
Schon 1931 errangen die Nazis erste parlamentarische Erfolge, terrorisierten die Straßen von Berlin und Potsdam. Der Wissenschaftler, Jude, aufgeklärte Kosmopolit stand ganz oben auf ihren Todeslisten.
Doch bevor Hitler im Januar 1933 die Macht übernahm, erhielt Einstein eine Einladung nach Kalifornien. Dort wurde er für seine Vorträge gefeiert – und erklärte, dass er nicht nach Deutschland zurückkehren würde. Aus Interviews und Aufzeichnungen geht hervor, dass er damals bereits wusste: Es würde ein Abschied für immer sein.
Domizil der Hitlerjugend
Das grüne Refugium, die stille Villa fernab des Berliner Lärms, blieb in den Krallen der Nazis zurück. Gerade vier Jahre hatte Einstein das idyllische Häuschen nutzen können, bevor er aus dem Land gejagt wurde.
Der Bürgermeister von Caputh frohlockte: Endlich konnte er Hand an die Idylle legen, plante ein Domizil der Hitlerjugend. Das Grundstück grenzt an Wälder, ideal für die militärische Erziehung künftigen Kanonenfutters – ganz im Sinne des Alten Fritz.
Gott würfelt nicht
1929 hatte der junge Architekt Konrad Wachsmann im Auftrag Einsteins eine Holzvilla auf das sanft abfallende Terrain gesetzt. Während der warmen Monate empfing der Physiker dort viele Gäste, mied die Großstadt und das wachsende Gebrüll der braunen Horden.
Gott würfelt nicht, hatte Einstein über seine Relativitätstheorie gesagt. Doch Hitlers Aufstieg würfelte Deutschland durcheinander, das war schon damals deutlich zu spüren. Zunehmend musste sich Einstein gegen Rassismus und Hetze wehren.
Und gegen die Schmährede von jüdischer Physik, deren Theorien die ehrbare deutsche Physik unterwanderten, wie der Jude den reinen Volkskörper. Ehrgeizige Emporkömmlinge trachteten nach den Lehrstühlen der jüdischen Wissenschaftler. Die Übernahme gelang: Unmittelbar nach Hitlers Vereidigung als Reichskanzler begann der Bann gegen die Juden.
Elite wanderte aus
Einstein bemühte sich, die besten Köpfe nach Amerika zu holen. Fast die gesamte Elite der europäischen Physik wanderte nach Übersee aus, an die Universitäten von New York, Chicago, Pasadena, Boston oder Princeton. Dort konnten sie ihre Arbeit fortsetzen, arbeiteten sie an neuen Waffen, an Waffen gegen Hitler und seine Schergen.
Denn Gott würfelt nicht, das hat die Geschichte immer bewiesen. Das Domizil für die Hitlerjugend blieb Wunschtraum, der Gemeinde Caputh ging das Geld aus. Der totale Krieg kam schnell, verwüstete Europa und fiel auf Deutschland zurück.
Bürgerhäuser fürs Bombertraining
Der junge Architekt Konrad Wachsmann war Mitte der 1930er Jahre erst nach Rom geflüchtet, dann nach Paris. 1941 kam er auf Vermittlung Einsteins in die USA. In der Halbwüste von Utah baute er unter anderem Berliner Bürgerhäuser nach.
Sie dienten amerikanischen Bomberpiloten zum Training. Später bildete er junge Leute aus, gehörte zur Avantgarde der modernen Architektur.
Ende des braunen Spuks
Im April 1945 trat die Rote Armee zur Schlacht um Berlin an, beendete den braunen Spuk. Zunächst hofften die Sowjets und später die junge DDR, dass Einstein zurückkommen würde. Aber er blieb in den USA, setzte nie wieder einen Fuß auf deutschen Boden.
Im Sommerhaus wohnte der örtliche Schankwirt. 1953 zog der Bürgermeister ein. Kurz vor Einsteins Tod 1955 wurde eine Gedenktafel errichtet und das Holzhaus unter Denkmalschutz gestellt.
Für Gäste geöffnet
Als sich der Bürgermeister 1958 in den Westen absetzte, zog eine Großfamilie mit Hühnern und Hunden ein. Erst Mitte der 1970er Jahre begannen Diskussionen, wie Einsteins Erben zu entschädigen und das verfallene Gebäude zu renovieren seien.
Anstoß gab die Aufnahme diplomatischer Beziehungen der kleinen DDR mit dem großen Amerika. Bis 1979 – dem hundertsten Geburtstag Einsteins – wurde das Haus instandgesetzt und für Besichtigungen und Gäste geöffnet. Die Akademie der Wissenschaften der DDR übernahm die Verwaltung, veranstaltete Seminare und Empfänge.
Wachsmann zeigte sich enttäuscht
Zur Wiedereröffnung reiste Konrad Wachsmann aus Los Angeles an. Offiziell lobte er höflich die Renovierung, privat zeigte er sich eher enttäuscht. Die verfaulte Täfelung im Wohnzimmer war unfachmännisch ersetzt worden, die Lasur der Holzverkleidung im Innern zu dunkel.
So ging die ursprüngliche Atmosphäre verloren. In der DDR erschien der Lebensbericht des Architekten als Wachsmann Report, später ergänzt durch Ein Haus für Albert Einstein (Autor: Michael Grüning) – als Vertiefung zum Thema unbedingt empfohlen.
13 Jahre Streit
Nach der Wende brach zunächst ein 13-jähriger Rechtsstreit aus. 1991 hatte die Gemeinde Caputh das Anwesen übernommen und dem Land Brandenburg übergeben. Erst 2004 wurden die rechtmäßigen Erben ins Grundbuch eingetragen.
Etwa siebzig Prozent gehören der Hebräischen Universität in Jerusalem, der Einstein den Großteil seines Vermögens vermachte. Rund 30 Prozent sind unter mehreren Erben in den USA aufgeteilt.
Neueröffnung im Einsteinjahr 2005
Während des Streits verfiel die alte Holzvilla zusehends. Feuchtigkeit drang durchs Dach, Witterung griff die Wände an, das Fundament bröckelte. 2001 wurde das Haus geschlossen.
Die Cornelsen Kulturstiftung und die Bundesrepublik legten Geld auf den Tisch. 2005 feierte die Welt das Einsteinjahr – hundert Jahre nach seinem bahnbrechendem Vortrag zur Relativitätstheorie im Saal der Sternwarte in Treptow. Pünktlich wurden die Arbeiten abgeschlossen und das Gebäude erneut für Besucher freigegeben.
Bescheiden und anspruchslos
Zwanzig Jahre später wird wieder gebaut, oder immer noch. Wer das Haus betritt, wundert sich über die düstere Atmosphäre im Innern, über die Enge, vielleicht Ausdruck von Bescheidenheit.
Die Täfelung ist dunkel und glatt, ebenso die Böden. Die winzigen Kammern lassen ahnen, wie einfach Einstein gelebt hat, nahezu anspruchslos. Einzig sein Arbeitszimmer mit Blick ins Grüne und den breiten Regalen für die Bücher deuten den Geist an, der hier wirkte.
Symbol der Verluste
Der Rundgang ist schnell beendet, persönliche Gegenstände von Einstein finden sich kaum. Einzig der wuchtige Schreibtisch im Arbeitszimmer hat die Zeiten überdauert. Glatt und schmucklos auch er: Symbol des Denkers, der keine Computer kannte und keine numerische Simulation.
Wer heute das Sommerhaus durchstreift, spürt vor allem dies: unsagbaren Verlust. Als die Rote Armee in Caputh einrückte, waren die besten Köpfe Deutschlands ermordet, schwer traumatisiert oder im Exil.
Manche kamen zurück, Einstein blieb in den Staaten. Er hatte genug von Überheblichkeit, Hass, Neid und Totschlag. Der größte Wissenschaftler, den Deutschland hervorgebracht hat, kehrte seiner Heimat den Rücken.
Website des Sommerhauses in Caputh
Albert Einstein: Die letzte Schlacht der Neider
Mehr zu lesen:
John Heartfield: Mit Schere und Spott gegen Hitler
Robert Capa in Leipzig: The Last Man to Die
Brecht und Weigel: Vom Umgang mit den Welträtseln
Hundert Jahre Bauhaus – mehr als blanke Fassaden
Käthe Kollwitz: Arbeit! Frieden! Brot!