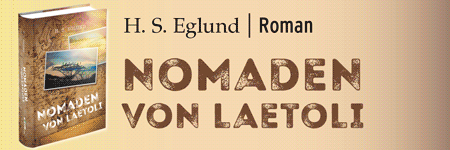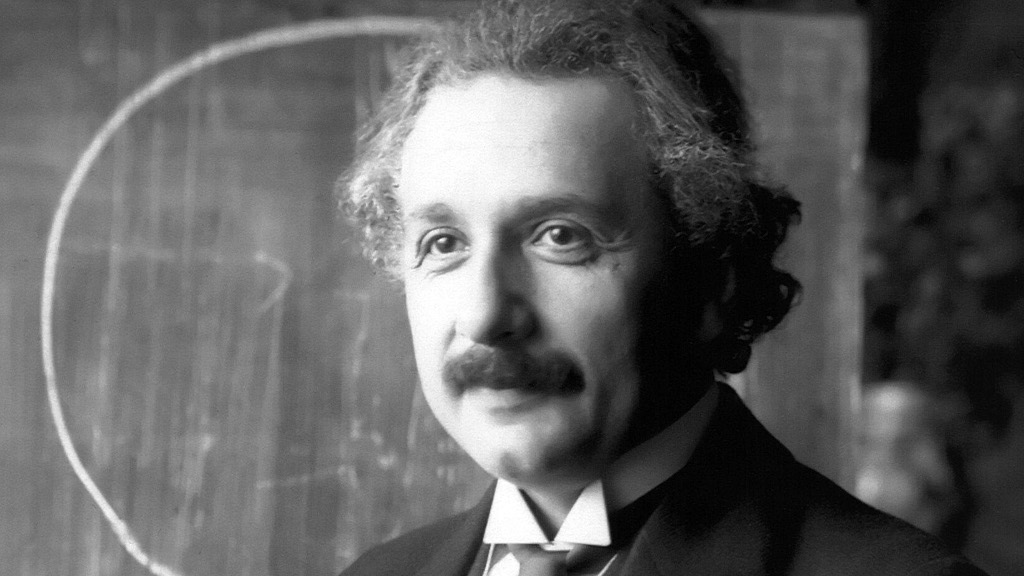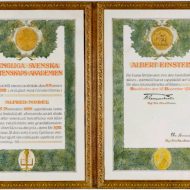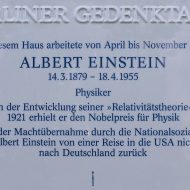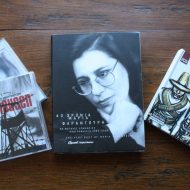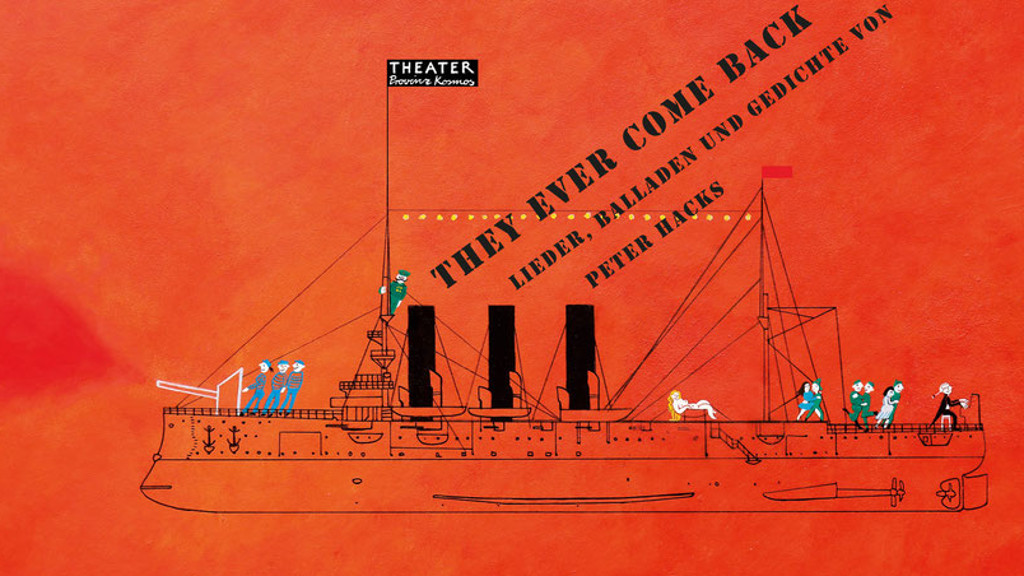Seit drei Jahrzehnten wird der 3. Oktober gewürdigt – als Feiertag der Nation, als Tag des Beitritts. Deutschland, Deutschland – blieb stecken im Kalten Krieg. Eine moderne Verfassung lässt bis heute auf sich warten.
Die Einen feiern diesen Tag als Sieg der überlegenen Wirtschaft im Westen über die Planwirtschaft der Realsozialisten. Andere freuen sich über die Restitution verloren geglaubter Grundstücke, Häuser und Fabriken.
Für manche Ossis steht der 3. Oktober als Offenbarungseid, als Termin des Jüngsten Gerichts: Konterrevolution, Rollback, Enteignung und Entmündigung und Arbeitslosigkeit.
Das Ende einer Selbstillusion
Und manchen im Westen des Landes und seiner Bundeshauptstadt beschleicht bis heute der Verdacht, dass dieser Tag das Ende feiner, sauberer Privilegien markierte, das Ende einer gewissen Sorglosigkeit. Das Ende der Selbstillusion, dass die Bundesrepublik Deutschland schon vor 1989 ein demokratischer Staat gewesen sei. Pustekuchen!
Rückblick zum Beginn der Teilung: Quasi über Nacht zur Trizone mutiert, vergoldeten US-Dollars die Niederlage, zumindest westlich der Elbe bis zum Rhein sowie auf der glückseligen Insel zwischen Dahlem und Tegel.
Der Osten blieb zurück. Die sowjetischen Besatzer demontierten, was mindestens Schrottwert hatte. Braindrain der Eliten nach Westdeutschland oder nach Osten, in die geheimen Atomstädte von Sibirien.
Feiertage offenbaren tiefe Psyche
Wie eine Nation ihre Feiertage wählt, offenbart die tief liegende Psyche, die Zerrissenheit ihrer Geschichte. Deutschland wählte einen Akt des Parlaments, den offiziellen Termin des Beitritt des DDR zum Grundgesetz im Jahr 1990.
Im Gespräch war damals der 9. November, der Tag des Mauerfalls. Vieles sprach dafür, doch dieses Datum war durch die Reichspogromnacht 1938 verdorben – für alle Zeiten ungeeignet für Partys.
Freilich, sowohl der Mauerfall als auch die Kristallnacht sah die Deutschen im trunkenen, grölenden Taumel, wie von Sinnen von leuchtenden Aussichten: Endlich durfte man den jüdischen Nachbarn die Scheiben einschmeißen und ihre Synagogen zündeln. Die Polizei rührte keinen Finger. Endlich durfte man in den Westen, zu Butterbergen, Bananen und Brauhaus. Wieder hielt die Polizei still, diesseits und jenseits der Grenze an Mauer und Zone.
Das Ende des Krieges
Doch damit genug der Gemeinsamkeiten. Die Kristallnacht von 1938 markierte das Vorspiel des Krieges und seiner Gewalt, die bald ganz Europa überzogen. Der Mauerfall 1989 brachte der Welt den Frieden, das Ende des Kalten Krieges, eigentlich das späte Ende des Zweiten Weltkriegs überhaupt. Das ist ein wichtiger Unterschied, wir wollen nicht simplifizieren.
Doch dass der nationale Festtag der neu vereinigten Deutschen ausgerechnet auf den 3. Oktober festgelegt wurde, spricht Bände: Nach den Aufständen der Bauern 1525 und der Proleten 1848 gab es erst 1989 wieder den Versuch, Deutschland von innen heraus zu demokratisieren. Der Aufstand im Osten des Landes, der den Mauerfall und die Vereinigung ermöglichte, bedeutete eine enorme politische Emanzipation der Bürger.
Die Angst der Abgeordneten am Rhein
Davor hatten die Abgeordneten am Rhein offenbar Angst. Ihr Grundgesetz, für die Nachkriegszeit als Übergangslösung definiert, sollte nach der Wiedervereinigung aller Besatzungszonen – wie von den Autoren des Grundgesetzes 1948 vorgesehen – von einer modernen, gesamtdeutschen Verfassung abgelöst werden.
Zu dieser Emanzipation war im Westen Deutschlands nur eine verschwindende Minderheit bereit. Zu viele Pfründe waren bedroht: Unionsparteien, Sozis und Liberale hatten sich in Bonn gemütlich eingerichtet.
Beamte machten weiter
Wahlen machte man unter sich aus. Der westdeutsche Wohlfahrtsstaat arrangierte sich gut damit. Nicht einmal das Beamtentum, tragende Säule von Hitlers Mordmaschine, wurde in Frage gestellt.
Und das Deutschlandlied – Deutschland, Deutschland, über alles – blieb gesamtdeutsche Hymne. Dabei besingt es die alte Feindschaft gegenüber den Franzosen. Der Dichter Heinrich Hoffmann von Fallersleben schrieb die Zeilen während der sogenannten Rheinkrise im August 1841.
Damals entfachten französische Ansprüche auf das Rheinland eine Welle des Nationalismus in den deutschen Ländern. Auf dieser Welle ritt der preußische Militarismus bis 1870/1871 zur Reichsgründung in Versailles und später zum Ersten Weltkrieg.
Das Grundgesetz ausgedehnt
Der Beitritt der DDR hat das westdeutsche Grundgesetz ausgedehnt bis Oder und Neiße. Solche Beitritte oder Anschlüsse hatte es schon vorher gegeben: den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich im Jahr 1938 und der Beitritt der Sudetendeutschen – mit der Annexion der Tschechei – im gleichen Jahr.
So bildet das Grundgesetz de facto noch immer das Gedankengut der 1940er Jahre ab, ist durch Begriffe wie (deutsches) Volk, (preußischer) Staat oder (patriarchale) Familie geprägt – gemäß der überkommenen Doppelmoral der Kirchen, die sich bis 1945 als Verbündete Hitlers bewährt hatten.
Demokratisierung abgesagt
Bis heute wurde nicht einmal der Versuch gemacht, eine wirklich demokratische Verfassung zu installieren – unter Einbeziehung der östlichen Länder. Deshalb steckt das politische System des wiedervereinigten Deutschlands im Nachkriegstrauma fest.
Die Montagsdemos in Leipzig und die Straßenschlachten in Dresden im Sommer und Herbst 1989 brachten zwar das System in Ostberlin zum Einsturz. Im Westen aber blieb alles beim Alten.
Das trunkene, lärmende Wahlvolk des Ostens war es, das Helmut Kohl und seine korrupte CDU im Sattel hielt – obwohl die Zeit längst reif war für einen Machtwechsel in Bonn – und für politische Modernisierung.
Ein zerißnes Volk – jedes Volk ist zerrissen
Man fühlte – und fühlt – sich an Friedrich Hölderlin erinnert, der vor zweihundert Jahren in seinem Hyperion schrieb:
Ich kann kein Volk mir denken, das zerrißner wäre, wie die Deutschen. Handwerker siehst du, aber keine Menschen. Denker, aber keine Menschen, Priester, aber keine Menschen, Herrn und Knechte, Jungen und gesetzte Leute, aber keine Menschen.
Hart ging der Poet mit seinen Leuten ins Gericht. Dabei litt er vor allem an den Franzosen, in die er allergrößte Hoffnungen gesetzt hatte. Doch der Versuch Robespierres, die Armen und Geknechteten aus dem Bauch von Paris in den Stand von Göttern zu erheben, scheiterte.
Weil Götter auch nur Menschen sind. So endete das göttliche Gelage – liberté, egalité, fraternité – im Terror der Guillotine. Aus dem Blut erhob sich Napoleon Bonaparte, um ganz Europa mit Terror zu überziehen. Er machte kurzen Prozess mit der Republik und erhob sich selbst zum Kaiser von Gottes Gnaden.
Das alte, immer wiederkehrende Lied
Die Franzosen lieben ihren kleinen Artillerieoffizier, der hunderttausende der besten Jungen und Männer des Landes auf seinen Feldzügen opferte – für das großartige Gefühl, eine Großmacht zu sein. Der Invalidendom in Paris steht bis heute für die Verherrlichung Napoleons, undenkbar in Deutschland oder England.
Obwohl diese Ambivalenz international ist, denn dieses Lied kehrt in der Geschichte immer wieder, überall: in der englischen Revolution unter Cromwell, bei den Italienern unter Garibaldi und später dem Duce, bei den Deutschen unter Adolf Hitler. Die Russen hatten Lenin und Stalin, die Chinesen ihren Mao Zedong.
Eine Liste der Feiertage
Die Franzosen haben die Erstürmung der Bastille am 14. Juli 1789 zu ihrem nationalen Festtag erklärt. Es war der Tag des ersten Toten der Revolution, des Leutnants Delaunay, dessen Kopf am Tor der Bastille aufgespießt wurde.
Die Engländer hingegen haben überhaupt kein offizielles Date. Lediglich das Geburtsdatum der Queen wird irgendwie begangen – mehr offiziös als mit Inbrunst. Australien hat es – historisch gesehen – leichter. Am 26. Januar 1788 trafen die ersten Siedler auf dem Fünften Kontinent ein, das ist heute der Australia Day.
Das katholische Irland geht sehr weit zurück: Saint Patrick’s Day am 17. März beruht auf dem mythischen Todestag des heiligen Patrick, datiert auf das Jahr 493. Japan zelebriert an seinem Nationalen Gründungstag die – gleichfalls im Mythos versunkene – Thronbesteigung von Kaiser Jimmu am 11. Februar 660 vor Christus.
Die Eidgenossen feiern jedes Jahr am 1. August mit großen Lagerfeuern auf den Bergen ihren Bundesbrief aus dem Jahr 1291, als sich die Talgemeinschaften Uri, Schwyz und Nidwalden gegenseitigen Beistands versicherten.
Und die USA feiern am 4. Juli ihren Independence Day, die Unabhängigkeit von der britischen Kolonialmacht im Jahr 1776. Ab diesem Tag wollten die 13 Kolonien nicht länger Untertanen von König George III. sein.
China marschiert am 1. Oktober eine Woche lang – in Erinnerung an die Verkündung der Volksrepublik im Jahr 1949. Die Goldene Woche gilt überall im Land als Urlaubszeit, dort sind mehr als eine Milliarde Menschen auf den Beinen, um Verwandte zu besuchen.
Unser Dank gilt dem Großen und Weisen Führer, Genossen Mao Zedong! Unsterblicher Ruhm der Kommunistischen Partei Chinas!
Zurück zu Hölderlins Klage
Zurück zu den Deutschen und Hölderlins Klage: Der Dichter aus Württemberg, der im Schatten von Goethe und Schiller (und anderen staatstragenden Poeten deutscher Zunge) stand, flüchtete sich in die Umnachtung. Ob er wirklich geisteskrank war oder den Wahnsinn nur spielte, darüber streiten die Gelehrten bis heute.
Fakt ist, dass es ein deutscher Handwerker war, der den verehrten Barden aus der Autenriethschen Nervenanstalt erlöste. Ernst Zimmer hatte Hölderlins Hyperion gelesen, und aus Liebe zum Dichter gewährte er ihm Asyl – im Turmzimmer am Neckar in Heidelberg, das bis heute zu besichtigen ist. Von 1807 bis zu seinem Tod im Jahr 1843 durfte Hölderlin dort wohnen und wurde leiblich versorgt.
Heines Sehnsucht nach der Heimat
Dass Deutschland kein leichtes Geburtsland ist, beweist auch Heinrich Heine. Im Liederzyklus Nachtgedanken (1844) ließ er seiner Sehnsucht freien Lauf:
Denk ich an Deutschland in der Nacht,
Dann bin ich um den Schlaf gebracht,
Ich kann nicht mehr die Augen schließen,
Und meine heißen Tränen fließen.
Die Jahre kommen und vergehn!
Seit ich die Mutter nicht gesehn,
Zwölf Jahre sind schon hingegangen;
Es wächst mein Sehnen und Verlangen.
Mein Sehnen und Verlangen wächst.
Heine, dessen republikanische Feder den preußischen Behörden missfiel, wurde ins Exil nach Paris gezwungen – wie Hölderlin ins innere Exil nach Tübingen. Sein Grab auf dem Friedhof von Montmartre ist ein Wallfahrtsort für seine Fangemeinde. Überraschend viele Blumen, Briefchen, Blumen und kleine Wimpel zieren die Marmorskulptur – auch 165 Jahre nach seinem Tod.
Meine Trauer, Du mein Fröhlichsein
Ost und West, Verfassung und Grundgesetz, Rückgabe und Entschädigung, Goethes Faust und Hitlers Kampf: Die Ambivalenz der deutschen Geschichte hat keiner so gut auf den Punkt gebracht wie der bayerische Dichter Johannes R. Becher, der nach dem Krieg in Ostberlin zum Kulturminister avancierte – und die Nationalhymne der DDR schrieb. Ihm soll hier das letzte Wort gehören:
Heimat, meine Trauer,
Land im Dämmerschein,
Himmel, du mein blauer,
Du mein Fröhlichsein
Einmal wird es heißen:
Als ich war verbannt;
Hab ich, dich zu preisen,
Dir ein Lied gesandt.
War, um dich zu einen,
Dir ein Lied geweiht,
Und mit Dir zu weinen
In der Dunkelheit …
Himmel schien, ein blauer,
Friede kehrte ein –
Deutschland, meine Trauer,
Du, mein Fröhlichsein.
Lesen Sie auch:
Tacitus und die Deutschen: Der erste Journalist der Zeitenwende
Brecht und Weigel: Vom Umgang mit den Welträtseln
Mit Peter Hacks in Ferropolis
Roman zur Wende 1989: Die Glöckner von Utopia